
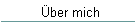
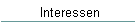
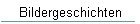
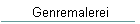
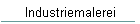

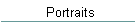

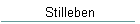
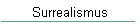

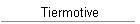
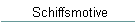
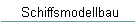

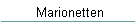

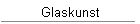
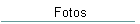
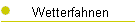
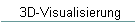
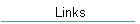
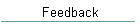
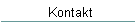
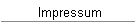
|
|
Meine Schmiedearbeiten
Die Werke des Künstlers
Am Anfang stand das historische Interesse an diesen Objekten die dem Wind so leidenschaftslos nachgeben. Erst als meine Schwester eine Wetterfahne von mir angefertigt haben wollte, wäre daraus fast ein weiteres Hobby geworden. Mehrere Jahre hatte der Verfasser auf dem Handwerkermarkt, der jährlich auf der Linner Burg stattfindet, einen Stand, wo er den interessierten Besuchern das Handwerk des Schlossers vorstellte.
|
|

|
|
Der klassische Hahn auf der Kirchtumspitze
Der Hahn auf der Kirchturmspitze ist das Zeichen einer christlichen Kirche.
Kupferblech 2 mm, Höhe: 40 cm Breite: 45 cm |
|

|
|
Zunftzeichen
Jedes Handwerk hatte im Mittelalter sein eigenes Zunftzeichen
Auslegerlänge: 1,30 m, Höhe 1,00 m |
|

|
|
Segelschiff vom Linner Flachsmarkt
Ein sogenannter Gaffelsschoner war die Vorlage für diese Wetterfahne, die der Verfasser an drei Tagen auf dem Linner Flachsmarkt fertigte. Der Rumpf des Schiffes besteht aus zwei Hälften wurde mit einem Kugelhammer getrieben und anschließend zusammengelötet.
Höhe: 1,70 m, Auslage: 1,30 m |
|

|
|
Wetterfahne
Diese um die Jahrhunderwende entstandene Wetterfahne wurde dem Original frei nachempfunden. In das Kupferblech kann ein Name oder eine Jahreszahl eingearbeitet werden.
Höhe: 1,70 m, Breite: 0,80 m |
|

|
|
Musikerwetterfahne
Freier Entwurf des Künstlers.
Höhe: 1,50 m, Auslage: 1,30 m |
|

|
|
Pflügender Bauer
Der pflügende Bauer, ein Anblick von Seltenheit. Dieser Typ der Wetterfahne ist am Niederrhein sehr verbreitet.
Höhe: 1,50 m, Auslage: 1,40 m |
|
|
Die Historie des Flachsmarktes
Flachs im Tausch

Die Herstellung von Wetterfahnen die sich im
Winde drehen, zeigt Detlef Stender den
staunenden Zuschauern auf dem Linner
Flachsmarkt.
Bild aus WZ Dienstag, 9. Juni 1987
|

Der Geusenengel stößt protestierend in die
Posaune. Bis er sich auf dem Kirchturm
drehen darf, kann noch Zeit vergehen.
Bild aus RP Dienstag, 10. Oktober 1987
|
Wie kam es zur Tradition des Flachsmarktes, die über Jahrhunderte aufrecht erhalten wurde? Der Flachsmarkt entstand um 1315 als Linn zur Stadt erhoben wurde. Mittelpunkt des damaligen Linn war der Andreasmarkt. Hierhin brachten die Bauern ihren Flachs und tauschten ihn gegen Dinge des Alltages ein.
Pferdegeschirr, Töpfe, Pfannen und andere Haushaltswaren waren die gebräuchlichsten Tauschobjekte jener Zeit. Der Flachsmarkt entwickelt sich schnell zu einem Jahrmarkt, der außer regen Tauschgeschäften zwischen den Bauern sowie den Händlern und Handwerkern auch der Volksbelustigung diente. Bald war der Flachsmarkt in Linn so populär geworden, dass er in den vergangenen Jahrhunderten viermal im Jahr stattfand.
Was den Linner Flachmarkt anbetrifft, gab es für das Ende dieses verwurzelten Brauchtums um die Jahrhundertwende eine ganz simple Erklärung. Als die Linner Bauern keinen Flachs mehr anbauten, war das Schicksal des Flachsmarktes in seiner ursprünglichen Bedeutung für immer besiegelt; der letzte Flachsmarkt fand 1903 statt und geriet dann in Vergessenheit, bis 1974 einige Heimatverbundene Linner Bürger die Initiative zu einem Neuanfang ergriffen.
So liegt die Organisation der Veranstaltung bei dem gemeinnützigen Verein„Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt“. Das Anliegen der Arbeitsgemeinschaft ist es, handwerkliche Traditionen durch Demonstration lebendig zu erhalten.
Der Linner Flachsmarkt einer der größten Handwerkermärkte findet jährlich zu Pfingsten statt.
In den Jahren 1986 und 1987 hat der Verf. das Handwerk des Schlossers auf dem Linner Flachsmarkt vorgeführt.
Mit besonderer Freude
fertigte er für die Linner Johanneskirche eine Wetterfahne an, die hoch oben auf dem Glockenturm heute noch die Windrichtung angibt. Der sogenannte Geusenengel, ein besonderer Wunsch des Pfarrers kann heute noch am Kohlplatzweg in Krefeld Linn besichtigt werden.
Technische Daten:
Wetterfahne in Form eines Engels bestehend aus:
-
einer Kugelgelagerten Drehvorrichtung (Eigenkonstruktion)
-
regenwassergeschützt
-
mit Rostschutzfarbe grundiert und zweifach schwarz gestrichen
-
Engel aus 2 mm Kupferblech, Posaune getrieben
-
Rohr aus dickwandigem Rohr mit Kupferrohrummantelung
-
Fuß mit Knotenblechverstärkter Platte und 4 Bohrungen für Schrauben
M 16
-
Gesamthöhe: 2.880 mm, Breite: 1.400 mm
-
Der Wetterfahne liegt eine Berechnung nach DIN 1055 Teil 4,
Lastannahmen für Bauten zu Grunde.
|

